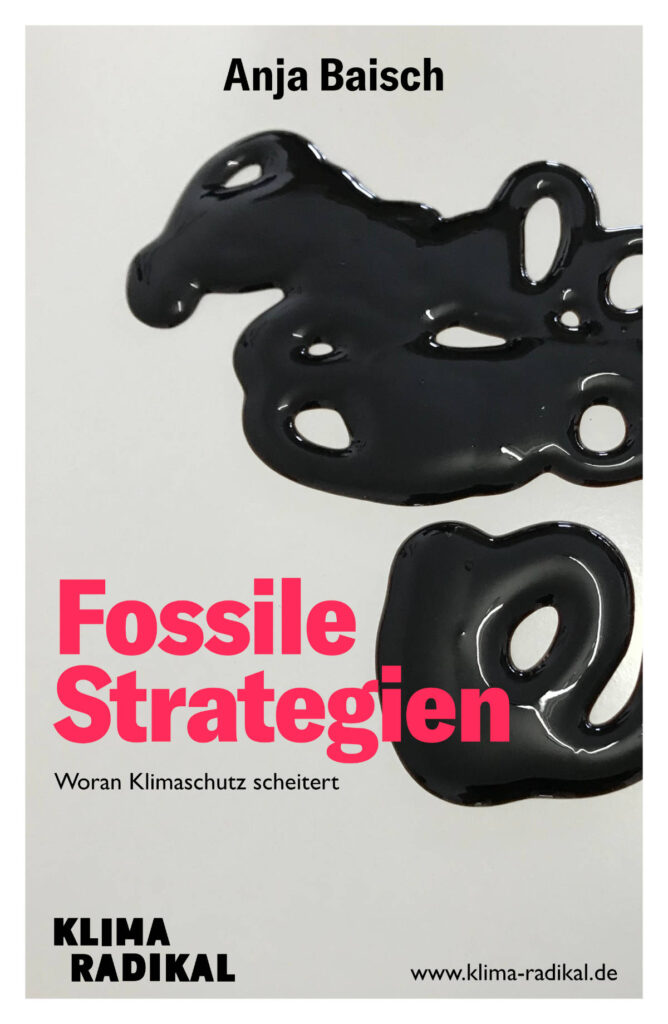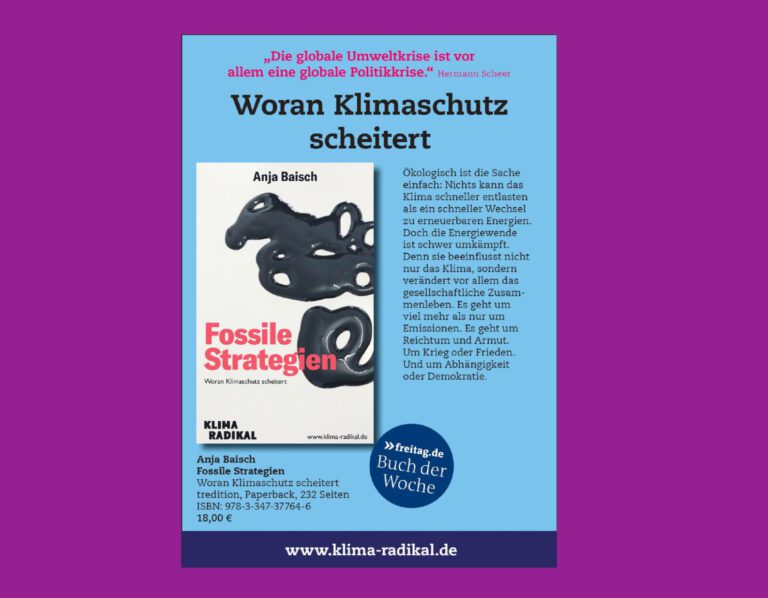Vor 50 Jahren war die Sache klar: Die vielen ökologischen Probleme auf der Erde erfordern eine andere Energieversorgung: Weg von den fossilen Brennstoffen, hin zu erneuerbaren Quellen. Das könnte so viele Umweltprobleme lösen, von vertrockneten Wäldern über übersäuerte Ozeane, Müllbergen aus Plastik bis zu Dürre- und Flutkatastrophen.
Für die Pioniere einer Energiewende war die Umstellung auf Erneuerbare aber nicht nur ein ökologisches Projekt, sondern auch eine politische Transformation. Denn eine dezentrale Struktur des Energiesystems würde tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen auf allen Ebenen bewirken – wirtschaftlich, verteilungspolitisch, sozial, außenpolitisch. In heftigen Interessenkonflikten agierten die solaren Vorreiter gegen die mächtige Fossilwirtschaft mit einem großen Ziel: Der wichtigste Wirtschaftssektor der Welt könnte fundamental umstrukturiert werden. Es winkte nicht weniger als eine sozialere, gerechtere und nachhaltigere Welt.
Heute ist alles anders: Die zahlreichen ökologischen Probleme werden meist auf „das Klima“ reduziert. Gestritten wird weniger um die konkrete Energiepolitik, als mehr über abstrakte Ziele, die Emissionen zu reduzieren. Auf internationalen Konferenzen ringen Regierungen um Prozente und Jahreszahlen, die sie über Spar- und Verbotsmaßnahmen durchsetzen wollen. Je ambitionierter die Ziele, desto repressiver die Maßnahmen. Klimaschutz erscheint als Last und Bürde, die allen Menschen Verzicht abverlangt.
Und die Energiewende? Diese große, kraftvolle Vision? Dieser Weg zu Unabhängigkeit, Energieautonomie, solidarischen Strukturen, regionaler Wertschöpfung, Umverteilung von oben nach unten und Frieden?
Um die Energiewende kreisen verschiedene Interpretationen. Und sie ist umstrittener denn je. Aber im Gegensatz zu früher verlaufen die Konfliktlinien heute anders. Kämpften damals die solaren Pioniere gegen die Fossilwirtschaft, gibt es heute neue Allianzen. Energiekonzerne inszenieren sich als Vorreiter der sauberen Energie, fordern staatliche Unterstützung ein und erhalten dafür viel Zustimmung, auch aus der Klimaschutzbewegung. Diesen Schwung nutzen die Energiekonzerne, um viele neue Strukturen zu schaffen – alles unter dem Label Klimaschutz.
Allerdings bekommen sie dafür auch einigen Gegenwind. Die Energiewende sei nur ein Vorwand, um die Überwachung und Kontrolle der Bürger durchzusetzen, vermuten Regierungskritiker. Ausgerechnet dieses Projekt, das ursprünglich für Autonomie und Unabhängigkeit stand, gilt vielen nun als Inbegriff einer repressiven Politik.
Das sind fundamentale Umdeutungen. In der Debatte kursieren so viele schönfärberische Begriffe, PR-Kampagnen und verwirrende Behauptungen, dass die zugrunde liegenden Interessenkonflikte kaum noch erkennbar sind.
Das ist das Thema dieses Blogs. Zurück zu den Wurzeln der energiepolitischen Konflikte mit der leitenden Frage: Was ist mit der Energiewende passiert? Wie konnte der visionärste Hebel zur Umgestaltung der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse so unter die Räder kommen?